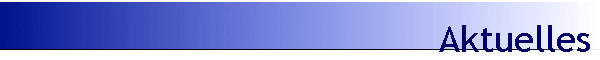
Schizophrenie als mögliche Folge von Mißbrauch diskutiert
Von Anke Hinrichs, SZ Wissenschaft 5.3.2002
Manche Menschen, die später an einer Psychose erkranken, sind in ihrer Kindheit oder Jugend durch Mißbrauch oder andere katastro-phale Ereignisse traumatisiert worden. Ob die Psychose dabei eine Folge des Traumas ist oder ob andere Faktoren zu der Häufung führen, ist umstritten. Auf einer Tagung des Universitäts-klinikums Hamburg-Eppendorf beklagten Psychi-ater nun, daß Patienten oft nicht nach solchen Erfahrungen gefragt werden - von einer Integra-tion spezifischer Traumabehandlung in die Therapie ganz zu schweigen. Es gebe "einen Nachholbedarf der Psychiatrie", so lautet das Fazit der Tagung.
Doch wie lassen sich Traumata in die gängigen Erklärungsmodelle für Psychosen einordnen? Bisher nimmt man an, daß es bei rund einem Prozent der deutschen Bevölkerung einmal im Leben zum Ausbruch einer psychotischen Störung kommt. Sie entsteht durch eine Kombi-nation genetischer und umweltbedingter Faktoren. Der zur Zeit gebräuchlichste wissenschaftliche Ansatz - das so genannte Diathese-Stress-Modell - geht davon aus, daß eine genetische Veranla-gung eine Überempfindlichkeit gegenüber Stress schaffe.
Der Stress der Erinnerung
Josef Aldenhoff von der psychiatrischen Uni-versitätsklinik in Kiel kritisierte in Hamburg, daß sich die Forschung dabei zu sehr auf die biolo-gische Sichtweise konzentriere und den emotio-nalen Kontext vernachlässige. "Endogene Psy-chosen können exogen ausgelöst werden", betonte Aldenhoff. Das heißt, daß die Umwelt bei entsprechender Veranlagung eine Krankheit erst ausbrechen läßt. Zum Beleg verwies der Kieler Psychiater auf eine neue Studie aus Israel. Danach könne massiver Stress bei Tieren dazu führen, daß in ihren Nervenzellen andere Gene abgelesen werden als zuvor. Das rufe eine blei-bende Übererregbarkeit hervor.
In diese Richtung forscht auch seit Jahren eine neuseeländische Studiengruppe um John Read von der Universität Auckland. Read präsentierte in Hamburg ein "traumabedingtes Neuro-Entwick-lungsmodell" (Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, Bd. 64, S. 319, 2001). Dabei baut er auf jüngere Erkenntnisse zur Traumaforschung: Demnach haben trauma-tische Ereignisse im sich entwickelnden Gehirn ähnliche organische Folgen, wie sie in den Gehirnen von schizophrenen Menschen festgestellt wurden. Dazu gehören Anomalien
im Stoffwechsel der Hirnbotenstoffe Dopamin und Serotonin, aber auch Schädigungen der Hippocampus-Region oder Rückbildungen im Gehirn.
Die These der Neuseeländer lautet nun: Kind-heitstraumata können neuro-physiologische Änderungen verursachen. Und der durch Erinnerungen an die früheren Erlebnisse hervorgerufene Stress löst dann später - je nach Heftigkeit und Verarbeitung des Traumas - eine mehr oder weniger schwerwiegende psychische Krise aus, mitunter eben auch Schizophrenie, meint Read. Mehrere Studien, vorzugsweise aus Nordamerika, belegen ihm zufolge, daß jede zweite schizophrene Krankenhauspatientin sexuell mißbraucht und fast ebenso viele körperlich mißhandelt worden waren. Bei Männern waren es 26 bis 39 Prozent (sexuell) beziehungsweise 44 Prozent (körperlich). In Deutschland gibt es dazu bisher keine Unter-suchungen. Kritiker bezweifeln allerdings einen direkten Zusammenhang.
Welche Symptome aber deuten speziell auf eine Traumageschichte hin? Harald Freyberger von der psychiatrischen Universitätsklinik in Greifswald nennt ausgeprägte Angstphänomene und so genannte dissoziative Störungen wie beispiels-weise Lähmungen, Amnesien oder Schmerz-syndrome. Er rät, das Trauma zur Sprache zu bringen und zu bearbeiten, um so die Behandlung der meist besonders schwer therapierbaren schizophren Erkrankten zu verbessern.
In Neuseeland wird zur Zeit ein Trauma-Trainings-programm entwickelt, mit dem das gesamte klini-sche Personal in Auckland darin geschult werden soll, Mißbrauchserfahrungen standardmäßig zu erfragen. Derweil werden in Deutschland erst einmal Daten gesammelt.
So wurde jetzt an der Hamburger
Universitäts-klinik unter Leitung von Dieter Naber eine Studie gestartet.
Anhand von 30 Patienten wollen die Ärzte die Häufigkeit von
Mißbrauchserfahrungen sowie die spezielle Symptomatik dieser Patienten
erfor-schen. Sie stehen den neuseeländischen Erkennt-nissen zur Häufigkeit
von Mißbrauchserfahrungen allerdings noch skeptisch gegenüber:
"Diese sind auch sehr von der Definition abhängig, und es liegen
erst wenige Studien vor", so der stellvertretende Klinikchef Michael
Krausz.